
- Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.
Johanni
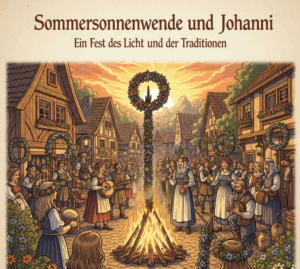 Sommersonnenwende und Johanni: Eine alte Verbindung im Tanz der Zeit und der Himmelskörper
Sommersonnenwende und Johanni: Eine alte Verbindung im Tanz der Zeit und der Himmelskörper
Der Juni ist ein Monat voller Licht, Wärme und uralter Geheimnisse. Für viele Kulturen auf der ganzen Welt ist es nicht nur den Übergang in den Sommer, sondern birgt zumindest in der westlichen, christlich geprägten Welt zwei eng miteinander verwobene Ereignisse:
Da wäre zum einen die Sommersonnenwende, ein rein astronomisches Phänomen. Und kurz darauf „Johanni“, ein Festtag, der dem Heiligen Johannes dem Täufer gewidmet ist.
Warum diese beiden Ereignisse eine genauere Betrachtung wert sind, zeigt die historisch gewachsene Verbindung zwischen den Wirren des Kalenderwesens und der präzisen Himmelsmechanik, durch die sich exakte Jahreszeiten unabhängig zu allen Kalendern bestimmen lassen.
Die Sommersonnenwende: Ein astronomischer Eckpfeiler der Zeitmessung
Beginnen wir mit der Sommersonnenwende, einem unbestreitbar präzisen und fundamentalen Ereignis:
Die Sommersonnenwende, auch als Sommersonnenstillstand bekannt, tritt auf, wenn die Sonne ihren höchsten Punkt am nördlichen Wendekreis erreicht, und der längste Tag des Jahres auf der Nordhalbkugel stattfindet. Dieses Ereignis ist kein kulturelles Konstrukt, sondern eine direkte Folge der Ekliptik, also der Erdneigung von etwa 23,5 Grad gegenüber ihrer Bahnebene um die Sonne. Diese Achsneigung bildet die Grundlage, auf dessen Basis die bekannten Jahreszeiten überhaupt entstehen.
Aber zurück zum Thema: am Tag der Sommersonnenwende steht die Sonne senkrecht über dem nördlichen Wendekreis. Auf der Nordhalbkugel bedeutet dies, dass die Sonneneinstrahlung am intensivsten ist und die Tage ihre maximale Länge erreichen. Nördlich des Polarkreises geht die Sonne an diesem Tag nicht unter – es ist die Zeit der Mitternachtssonne. Südlich des Äquators ist es genau umgekehrt: Dort beginnt mit der Wintersonnenwende der Winter, es ist der kürzeste Tag des Jahres.
Aber damit nicht genug …
Die Sommersonnenwende ist eine von vier astronomisch definierten Eckpunkten des Jahres, die Klima und Vegetation maßgeblich prägen:
Frühlingstagundnachtgleiche (um den 20./21. März)
Die Sonne steht senkrecht über dem Äquator, Tag und Nacht sind annähernd gleich lang. Sie markiert den Beginn des Frühlings auf der Nordhalbkugel.
Sommersonnenwende (um den 20./21. Juni)
Die Sonne erreicht ihren nördlichsten Punkt, der längste Tag auf der Nordhalbkugel. Sie markiert den astronomischen Beginn des Sommers.
Herbsttagundnachtgleiche (um den 22./23. September)
Die Sonne steht erneut senkrecht über dem Äquator, Tag und Nacht sind wieder annähernd gleich lang. Sie markiert den Beginn des Herbstes auf der Nordhalbkugel.
Wintersonnenwende (um den 21./22. Dezember)
Die Sonne erreicht ihren südlichsten Punkt, der kürzeste Tag auf der Nordhalbkugel. Sie markiert den astronomischen Beginn des Winters.
Diese vier Punkte teilen das Jahr in vier beinahe gleich lange Abschnitte – die astronomischen Jahreszeiten. Sie sind von Haus aus präzise definiert durch die Position der Erde in ihrer Umlaufbahn und ihre Achsenneigung relativ zur Sonne. Die jährliche Wiederkehr dieser Ereignisse ist von fundamentaler Bedeutung für das Leben auf der Erde und ermöglichte überhaupt erst eine verlässliche Zeitmessung, die Verfolgung eines Jahresverlaufs, und ja, die Natur hat sich auf diese kosmischen Ereignisse eingerichtet.
Die Bedeutung der Jahreszeiten im globalen Kontext: Von Äquator zu den Polen
Denken wir jetzt ein Runde größer…: Die Relevanz der Jahreszeiten und damit auch der Sonnenwenden steigt dramatisch, je weiter man sich vom Äquator zu den Polen hinbewegt. Am Äquator selbst gibt es kaum ausgeprägte Jahreszeiten, da die Sonneneinstrahlung das ganze Jahr über konstant ist. Die Tage sind immer etwa 12 Stunden lang, und die Sonne steht das ganze Jahr über hoch am Himmel, zweimal im Jahr sogar exakt im Zenit. Klimatische Variationen sind ein wenig vereinfacht betrachtet eher durch Regen- und Trockenzeiten geprägt, die mehr mit globalen Windsystemen zusammenhängen als mit der Prägung durch die jahreszeitlich bedingte Position der Sonne.
Nun gut, je weiter man sich jetzt vom Äquator entfernt, desto stärker macht sich die Neigung der Erdachse bemerkbar: In den mittleren Breiten, wo die meisten alten Hochkulturen entstanden sind, ist der Unterschied zwischen Sommer und Winter eklatant. Lange, warme Sommertage ermöglichen das Wachstum von Pflanzen und die Reifung von Früchten, während kurze, kalte Wintertage die Natur in eine Art von Ruhephase zwingen. Für Ackerbaukulturen war das Wissen um den Zeitpunkt der Sonnenwenden und Tagundnachtgleichen von existentieller Bedeutung – Sie bestimmten letztendich den optimalen Zeitpunkt für Aussaat und Ernte, für die Vorbereitung auf den Winter oder die Wiederaufnahme der Arbeit im Frühling. Die Beobachtung der Gestirne und insbesondere der Sonne wurde mittelfristig zu einer Wissenschaft für sich, die über Leben und Tod entscheiden konnte. Wie extrem sich das auswirken kann, zeigt sich, wenn man die Polregionen reist. Am Nord- und Südpol zeigen die Jahreszeiten sich von ihrer extremsten Seite:
Hier gibt es monatelange Polartage, in denen die Sonne nicht untergeht, gefolgt von monatelangen Polarnächten, in denen die Sonne überhaupt nicht zu sehen ist. Die Sommersonnenwende markiert hier den Höhepunkt des Lichts, die Wintersonnenwende den Höhepunkt der Dunkelheit. Das Leben in diesen Regionen ist vollständig den extremen Schwankungen der Sonneneinstrahlung unterworfen.
Diese astronomisch bedingten Zyklen des Lichts und der Wärme haben die Entwicklung des Lebens, die Ökosysteme und natürlich auch die menschliche Kultur und Spiritualität tiefgreifend beeinflusst. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Sommersonnenwende in vielen alten Kulturen als ein Fest des Lebens, der Fruchtbarkeit und der Höhepunkt des Jahres gefeiert wurde.
Johanni: Ein christliches Fest im Sog der Sommersonnenwende
So, und mit diesem Hintergrundwissen wird das Johannisfest oder Johanni erst richtig interesant, denn es ist ein Paradebeispiel, wie die frühe Kirche diese Tage in den Glauben integriert hat, und mit welchem Kalkül dabei vorgegangen wurde… 🙂
Das Wesentliche zuerst:
Das Johannisfest, oder Johanni, wird traditionell am 24. Juni gefeiert und ist dem Heiligen Johannes dem Täufer gewidmet, dessen Geburt sechs Monate vor der Geburt Jesu (Weihnachten am 25. Dezember) angesetzt wird.
Ob das jetzt tatsächlich so war, kann man im Raum stehen lassen, Implikativ gesehen war diese Rechnung jedoch nicht unbedingt ein Zufall, denn Johannes selbst sagte über Jesus: „Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen“ (Johannes 3,30). Wer hätte das gedacht, passenderweise fällt der Johannistag in genau die Zeit, in der die Tage nach der Sommersonnenwende kürzer werden, während Weihnachten in die Zeit fällt, in der die Tage nach der Wintersonnenwende wieder länger werden. Das Gesamtbild zeichnet damit ein Spiel von Licht und Schatten, von Zunahme und Abnahme, das sich in diesen Festtagen widerspiegelt – und bei der Gelegenheit jede Menge Stoff für christlich geprägte Geschichten produziert, mit denen Wanderprediger zu beeindrucken wussten, um plausible Erklärungen zu liefern. Das ändert aber nichts daran, dass der 24. Juni nicht der genaue Tag der Sommersonnenwende ist, sondern einige Tage danach. Das „warum“ ist der Punkt, an dem Kalender-Rechnereien ins Spiel kamen, mit denen man sich am Ende selber ausgetrickst hat.
Der Gregorianische Kalender und die Verschiebung der Zeit
Jahrhunderte, bevor der heute weltweit verwendete Gregorianische Kalender eingeführt wurde, war der Julianische Kalender in Europa dominant. Dieser wurde 45 v. Chr. von Julius Caesar eingeführt und wurde seinerzeit als enorme Verbesserung gegenüber den vorhergehenden, oft chaotischen römischen Kalendern gefeiert. Im Kern legte der Julianische Kalender den Grundstein für eine einheitliche Kalenderrechnung, und setzte bei der Gelegenheit Länge eines Jahres auf 365,25 Tage fest. Um die 0,25 Tage auszugleichen führte man alle vier Jahre einen Schalttag ein. Dies war eine sehr gute Annäherung an die tatsächliche Länge eines Sonnenjahres (tropisches Jahr), das etwa 365,24219 Tage beträgt. Der kleine Unterschied von etwa 11 Minuten und 14 Sekunden pro Jahr scheint auf ein Menschenleben gerechnet nicht so wichtig, aber über Jahrhunderte hinweg konsequent durchgezogen wird daraus eine sehr respektable Zeitverschiebung:
Dieser kleine Fehler hatte das Potenzial, grob alle 128 Jahre sich zu einem ganzen Tag hochzuschaukeln. Dies wurde für die Kirche insofern zu einem Problem, da es die Berechnung für kalendarisch festgelegte Feiertage wie auch das Osterterfest massiv beeinflusste:
Das Konzil von Nicäa im Jahr 325 n. Chr. hatte nämlich festgelegt, dass Ostern am ersten Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond gefeiert wird – man wollte verhindern, dass Ostern und der Beginn des jüdischen Pessachfest, welches mit dem ersten Frühlingsvollmond beginnt, auf denselben Tag fallen. Und wenn man jetzt schlauerweise den ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond nimmt, kann das konsequenterweise nicht passieren. Um die Sache jetzt einfach berechnen zu können, wurder der Frühlingsanfang in diesem Zusammenhang auf den 21. März gelegt. Das war für sich betrachtet noch nicht das Problem, aber durch den Fehler des Julianischen Kalenders verschob sich der tatsächliche Frühlingsanfang (die Frühlingstag-/nachtgleiche) im Kalender langsam weiter nach vorne.
Im 16. Jahrhundert war der astronomische Frühlingsanfang bereits auf den 11. März im Julianischen Kalender gefallen – ein kalendarischer Fehler von 10 Tagen. Und Querbezug sei Dank, was für das Osterfest ein Problem war, wirkte sich logischerweise auch auf Johannisfest aus. Naja, auf jeden Fall, Papst Gregor XIII. erkannte dringenden Handlungsbedarf, und führte 1582 kurzerhand den nach ihm benannten Gregorianischen Kalender ein.
Die wichtigste Korrektur war zum Einen das Überspringen von Tagen: Um den angesammelten Fehler zu korrigieren, wurden im Oktober 1582 kurzerhand 10 Tage übersprungen. Auf den 4. Oktober folgte direkt der 15. Oktober. Um zu verhindern, dass dieses Schlamassel noch einmal geschieht, überlegte man sich in diesem Zug auch eine neue Schaltjahrregel: Während der Julianische Kalender alle vier Jahre einen Schalttag hatte, führt der Gregorianische Kalender einen Schalttag nur dann ein, wenn das Jahr durch 4 teilbar ist, außer in vollen Jahrhunderten (z.B. 1700, 1800, 1900), es sei denn, das Jahrhundert ist durch 400 teilbar (z.B. 1600, 2000). Diese Regel ist deutlich präziser und reduziert den Fehler auf etwa einen Tag in 3.030 Jahren.
Johanni vor der Kalenderreform: Zeitlich dichter an der Sommersonnenwende
Diese Kalenderreform hatte direkte Auswirkungen auf die relative Lage von allen kirchlichen Festtagen und astronomischen Ereignissen, wie man am Beispiel von Johanni gut sehen kann:
Bevor der Gregorianische Kalender eingeführt wurde, wurde Johanni am 24. Juni im Julianischen Kalender gefeiert. Da der Julianische Kalender im 16. Jahrhundert bereits etwa 10 Tage hinter dem astronomischen Jahr lag, bedeutete das, dass der 24. Juni im Julianischen Kalender faktisch dem 14. Juni im heutigen Gregorianischen Kalender entsprach. Gefeiert wurde unbeeindruckt hiervon die Sommersonnenwende trotzdem am 20./21. Juni, und dem Volk war das auch egal, dass hier etwas nicht stimmte. Alteingesessene Traditionen interessieren sich nicht dafür, dass die ursprüngliche Nähe des Johannistages zur Sommersonnenwende entstand, als der Julianische Kalender noch neu war, und die Sommersonnenwende seinerzeit auch tatsächlich am den 21. Juni im Julianischen Kalender zelebriert wurde. Das war jetzt erst einmal für sich gesehen als Ereignis wohl weniger dramatisch, aber der fehlende Querbezug zu kosmischen Himmelsereignissen führte schleichend eben auch zu einer Entfremdung zwischen christlichen Festen und irgendwelchem „Aberglauben“.
Lange Rede, kurzer Sinn, diese etwas verfahrene Situation machte es 1582 natürlich schwierig, am 24. Juni ein Johannisfest zu feiern, das 3 Tage nach der Sommersonennenwende stattfinden soll, wenn die astronomische Sommersonnenwende tatsächlich um ca. 13-14 Tage zuvor war…
Nach 1582 (Gregorianischer Kalender):
Wie auch immer, Gregor XIII. hat festgestellt, dass das so nicht weitergehen kann. Und das Ergebnis seiner Reform konnte sich sehen lassen:
Johanni wurde kalendarisch betrachtet nicht verschoben, und blieb am 24. Juni. Das Datum für die astronomische Sommersonnenwende wurde jedoch durch die Kalenderreform korrigiert, und auf ihren korrekten Termin um den 20./21. Juni gesetzt, und gleichzeitig das Problem mit der kalendarischen Drift angegangen. Dadurch wurde der Abstand zwischen Sommersonnenwende und Johanni auf die heutigen 3-4 Tage mehr oder weniger festgeschrieben.
Die Überlappung von Heidentum und Christentum
Doch warum hat man gerade in der frühen Kirche die Sommersonnenwende so wichtig empfunden? Den Johannistag in genau diesen Zeitraum zu legen, war nämlich vieles, aber kein Zufall: Überall in Europa wurden zur Sommersonnenwende Feste gefeiert, die die Kraft der Sonne, die Fruchtbarkeit der Erde und den Höhepunkt des Jahres feierten. Sonnenwendfeuer wurden entzündet, Kräuter gesammelt und Rituale zur Abwehr von Unheil oder zur Förderung der Ernte durchgeführt.
Diese Traditionen waren tief in der Bevölkerung verwurzelt und konnten nicht einfach ausgelöscht oder gar ignoriert werden. Hier zeigt sich die Kreativität der frühen Kirche. Heidnische Bräuche wurden nicht wie immer wieder behauptet verboten, sondern man hat kurzerhand christliche Zusammenhänge ge- und bei Bedarf auch erfunden, auf deren Basis dann Festtage umgedeutet, und mit christlichem Kontext von Wanderpredigern verbreitet wurden. Solche Manöver zeigen sich zum Beispiel, wenn man das Geburtstagsfest Johannes des Täufers auf diesen prominenten Zeitpunkt legte – Die Kirche konnte sowohl die ohnehin vorhandene Feierlaune als auch die Bräuche kanalisieren und heimlich christianisieren. So wurden aus Sonnenwendfeuer die beliebten Johannisfeuer, und die alten Rituale bekamen einfach mal eine völlig neue, religiöse Bedeutung. Die Heiligkeit des Ortes und der Zeit blieb erhalten, aber die Deutungshoheit wechselte mit steigender Anzahl Feiernder unter der Hand den Besitzer….
Bis heute sind viele dieser vorchristlichen Bräuche mit dem Johannistag verbunden:
- Johannisfeuer: Der wohl bekannteste Brauch. Das Springen über das Feuer soll Glück bringen, reinigen und vor Krankheiten schützen. Die Asche galt als fruchtbarkeitsfördernd.
- Kräutersammeln: Johanniskräuter, insbesondere Johanniskraut (Hypericum perforatum), das um diese Zeit blüht, werden gesammelt. Ihnen wird eine besondere Heilkraft zugeschrieben, die durch die Sommersonnenwende verstärkt sein soll.
- Tanz und Gesang: Fröhliche Feste, Tanz und Gesang begleiten die Feierlichkeiten oft bis tief in die längste Nacht des Jahres.
Diese Bräuche sind ein lebendiges Erbe der tiefen Verbindung zwischen dem natürlichen Jahreszyklus und der menschlichen Spiritualität, eine Verbindung, die durch die Jahrtausende hinweg bewahrt wurde, auch wenn sich die interpretativen Rahmenbedingungen geändert haben.
Johannes der Täufer: Wegbereiter und Symbol
Was genau wird da jetzt eigentlich traditionell am 24. Juni gefeiert, und welchen Weitblick hatte die frühe Kirche hier bewiesen?
Historisch betrachtet ist es plausibel, dass die frühe Kirche einen derart prominenten, bereits bestehenden heidnischen Feiertag nicht ignorieren konnte, sondern transformieren wollte: Das Johannisfest wurde so zu einem Meilenstein im Kirchenjahr, der die Zeit zwischen Ostern und Weihnachten strukturiert, und eine Brücke zwischen der Auferstehung Christi und seiner Geburt schlägt.
Das Johannisfest liefert den Grund für die Geburt des heiligen Johannes dem Täufer, der sechs Monate vor der Geburt Jesu (Weihnachten am 25. Dezember) war. Die Gestalt des Johannes des Täufers wird dadurch von zentraler Bedeutung für die christliche Botschaft:
Er wird in der Bibel als Wegbereiter für Jesus beschrieben, als derjenige, der „die Wege des Herrn ebnete“. Seine Geburt war von wundersamen Umständen begleitet, und sein Leben war von Askese und Predigt geprägt. Er taufte die Menschen im Jordan und rief zur Buße auf. Theologisch wird er zudem oft als die letzte große Prophetengestalt des Alten Testaments, und als Brückenfigur zum Neuen Testament verstanden:
Johannes war derjenige, der das „wahre Licht“ – Jesus Christus – ankündigte. Er selbst war „nicht das Licht, sondern sollte Zeugnis ablegen für das Licht“ (Johannes 1,8). Indem sein Geburtstag auf den Zeitpunkt gelegt wurde, an dem die Sonne ihren Zenit überschreitet und die Tage kürzer werden, wird seine Rolle als Vorläufer und Wegbereiter symbolisch verstärkt.
Er weist auf das kommende, ewige Licht hin, während das natürliche Licht der Welt nun abnimmt. Dies schafft eine tiefgründige Parallele zwischen dem Naturgeschehen und der Heilsgeschichte. Die Wahl des 24. Juni als Geburtstag des Täufers hat somit keine direkte biblische Grundlage, sondern ist vielmehr eine theologische Konstruktion, die auf der Festlegung des Weihnachtstermins auf den 25. Dezember basiert, und die sechsmonatige Schwangerschaft Elisabeths (Mutter des Johannes) und Marias (Mutter Jesu) berücksichtigt.
Die Anpassungsfähigkeit und die tiefe Verwurzelung dieser Bräuche im Volksglauben, die durch kosmische Ereignisse fundiert sind, machten es der Kirche nicht nur unmöglich, sie ersatzlos zu streichen:
Stattdessen wurden sie eher mit dem christlichen Kontext um eine erstaunliche Facette erweitert und durch die Dominanz der christlichen Kirche mal mehr und mal weniger erfolgreich überdeckt. Dies führte zu einer faszinierenden Synthese, in der sich alte Naturverehrung und neue theologische Bedeutung auf einzigartige Weise miteinander verbanden.
